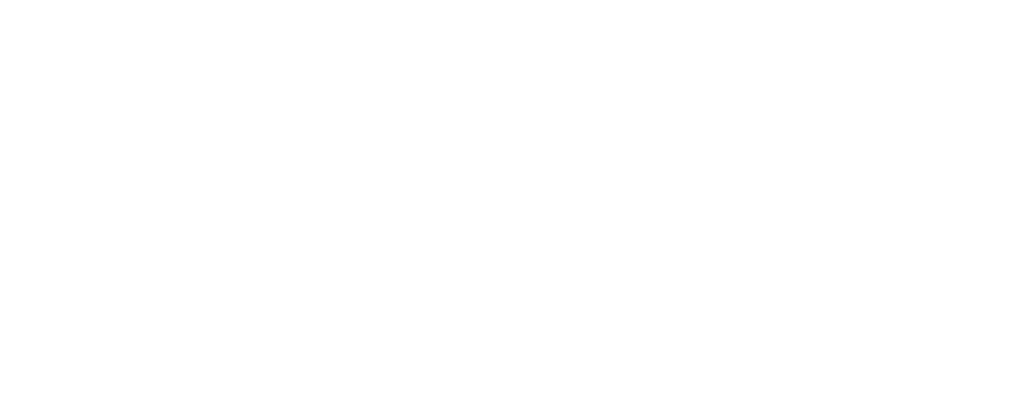Sie sind im Januar in Oldenburg um Ihren Film Die Mondverschwörung vorzustellen und zu diskutieren. Er hat sich ja erst nachträglich über Ausschnitte bei Youtube und die sozialen Netzwerke zu einem Kultfilm entwickelt, oder?
Ja, ich habe bei dem Film zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, wie einer meiner Filme durch das Internet eine nachträgliche Bekanntheit erzielt hat. Das war bei dem Start des Films völlig anders, da war das Interesse gar nicht so groß. Als ich den Film damals in Oldenburg vorgestellt habe, das war im ‚Casablanca‘, da fand der Film weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist heute anders und natürlich sehr erfreulich.
Der Film ist jetzt etwa zehn Jahre alt, seitdem hat sich bei der gesellschaftlichen Bedeutung von Verschwörungstheorien natürlich sehr viel getan. Hatten Sie nach bei dem Film, der ja in gewisser Hinsicht schon den Eindruck evoziert, dass es enorm viele und durch alle Milieus und Schichten verteilte Anhänger dessen in Deutschland gibt, schon befürchtet, dass das Thema noch bedeutender werden würde?

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat schon vor Jahren mal anlässlich der Frankfurter Buchmesse veröffentlicht, dass etwa ein Viertel aller Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt aus einem im weiteren Sinne esoterischen Umfeld kommen, wobei dazu dann aber auch die ganze Ratgeberliteratur gehört.
Die esoterische Autorin Johanna Paungger zum Beispiel, die auch in dem Film auftaucht auf, verkauft ihre Mondbücher millionenfach. Der Film fängt ja nicht gleich mit den extremen und antisemitischen Verschwörungstheoretikern an, sondern mit recht harmlosen Sachen wie Mondgymnastik oder mit Menschen, die nur Wasser trinken, das bei Vollmond abgefüllt wurde. Man sieht diese Situationen und denkt sich, was ist mit den Leuten los, aber es ist noch nicht gefährlich.
Der Film hat also eine eskalative Struktur, das heißt er startet bei harmlosen Esoterikfällen und führt zu immer krasseren Verschwörungstheorien, die die Konsequenz der ersten aufzeigen?
Ja, das war der Gedanke zum Aufbau, ich hoffe zumindest, dass das so verständlich geworden ist. Ich wollte mit dem Film aber nicht sagen, dass diese esoterischen Praktiken alle zwangsläufig zu den späteren Extremen führen. Aber wenn man sich erst einmal auf das Glatteis des nicht mehr mess- und beweisbaren begibt, kann es natürlich passieren, dass man ins Rutschen kommt.

Ihr Film regt zu einer eigentümlichen Art des Schmunzelns an, ein Schmunzeln über die Verrücktheiten der gezeigten Personen und den heiligen Ernst, mit dem diese ihre Theorien vortragen. Diese Form der Verschwörungstheorien konnte man bis vor einiger Zeit auch noch so einschätzen, dass das eben randständige Spinner sind. Meinen Sie rückblickend, dass das vielleicht zu einer durchaus auch problematischen Wahrnehmung von Verschwörungstheorien führte?
Wenn ich selbst bei einer Aufführung dabei bin, dann weise ich immer darauf hin, dass man nicht darüber lachen sollte. Das klappt aber leider nie richtig. Natürlich sind die in Film ausgebreiteten Parallelwelten zumindest kurios und zum Teil grotesk – aber wenn man weiß, dass auch Teile der nationalsozialistischen Ideologie solchen esoterischen Weltbildern entsprungen sind, wird es schnell wieder sehr ernst. Im Übrigen lege ich Wert darauf, dass sich der Film nicht über seine Protagonisten lustig macht. Selbst, wenn sie im Kino mitkriegen würden, dass andere Zuschauer über all das lachen, an das sie glauben, denken sie wahrscheinlich, dass diese Leute das wohl noch nicht ernst genug nehmen und es vermutlich einfach noch nicht durchschaut haben. Sie nehmen das dann sogar als eine weitere Motivation, die Unwissenden aufzuklären.
Dieses missionarische Bewußtsein ist oft sehr groß. Mit Herrn Petersen waren wir zum Beispiel, wie man es auch im Film sieht, in Berlin auf einer Polizeistation, weil er eine Anzeige wegen der ‚Chemtrailbedrohung‘ erstatten wollte. Er war sehr froh darüber, dass es einmal jemanden gab, der das der Öffentlichkeit zeigen wollte. Er litt unter irgendwelchen, wahrscheinlich psychosomatisch bedingten – Schmerzen, und durch die Chemtrailtheorie hat er eine Erklärung dafür gefunden. Klingt ja auch logisch: das kommt von den gefährlichen Substanzen, die jemand in die Luft sprühte. Das ist ein Musterbeispiel einer Verschwörungstheorie. Die Wirklichkeit ist komplex und es gibt für vieles keine konkreten Gründe, die Verschwörungen eignen sich dann wunderbar dafür, diese komplexe Wirklichkeit zu vereinfachen und einfache Erklärungen zu geben. Das erklärt zu einem gewissen Teil auch die Beliebtheit der Verschwörungserzählungen.
Als wir die Leute damals interviewt haben, standen sie zwar miteinander in losem Kontakt, waren aber bei weitem nicht so stark vernetzt wie heute. Für einen Teil des rechten Spektrums waren diese Parallelwelten zugleich so eine Art Flucht in die innere Emigration. Heute ist in der Szene eine ganz andere Zeigebereitschaft erkennbar. Sie warten nicht mehr darauf, bis Dennis kommt und sie interviewt, sondern sie haben längst im Internet ihre eigenen Medienkanäle aufgebaut6 und sprechen offen aus, was sie vor zehn Jahren nur angedeutet haben. Und, was noch gefährlicher ist: auch die Zahl derer, die solchen Positionen applaudieren, scheint zuzunehmen.
Ich denke, auch in den aktuellen Hygiene-Demos gibt es diesen Zusammenhang.Impfgegner beziehen sich auf esoterische Positionen und das findet man dann auch bei offen nationalistischen Personen wie Nikolai Nerling oder Attila Hildman.
Ja – die Schnittmenge zwischen Esoterik und autoritären, demokratiefeindlichen Positionen ist nach wie vor groß. Das lässt sich auch bei vielen Sekten beobachten: wer glaubt, die allein seligmachende Wahrheit gefunden zu haben, verhält sich meist sehr intolerant gegenüber Andersdenkenden. Schon vor Jahren hat eine Landeszentrale für politische Bildung in einer Studie die Esoterik als eines der Haupt-Einfallstore rechten Gedankenguts in die Jugendkultur bezeichnet.
Oft klingt es im Film, als wären die Leute weniger von Esoterik beeinflusst als vielmehr von schlechter Science-Fiction, wenn von Außerirdischen und der Entführung auf UFOs die Rede ist. Gibt es auch einen systematischen Bezug zu solchen Genreelementen?
Nein, das hat einen anderen Grund. Diese Elemente, die Sie mit Science-Fiction verbinden, wurzeln zumeist in der theosophischen Lehre der Helena Blavatski und vermischen sich mit der darauf aufgebauten „Ariosophie“ der Guido-von-List-Gesellschaft. Sie haben also ebenfalls einen Ursprung in der Esoterik, im esoterischen Denken. Dort taucht dann zum Beispiel auch das Motiv ‚Alderberan‘ auf, also der Glaube, dass Außerirdische vom Planeten Alderbaran kommen. Es gibt dann die Vorstellung, dass die ‚Arier‘ Nachfahren dieser außerirdische Rasse sind und zuerst nach Nordeuropa kamen. Der frühere Nationalsozialist und SS-Soldat Wilhelm Landig hat im Kontext solcher esoterischen Vorstellungen eine dreibändige Geschichte, die so genannte Thule-Trilogie, veröffentlicht, die dann auch für die bei rechten Verschwörungstheorien nicht unwichtige Thule-Gesellschaft zu einem zentralen mythologischen Vorreiter wurde. Im Film sieht man ein Interview mit Reiner Feistle, der Bücher zu dem Thema Aldebaran veröffentlich hat, hier gibt es einen deutlichen Bezug von Esoterik, nationalsozialistischer Symbolik und dem UFO-Glauben. Manche meinten ja, als der Film vor zehn Jahren herauskam, ich hätte mich bei dem Film „Iron Sky“ bedient, bei dem es ja darum geht, dass die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes eine geheime Basis hätten. Mein Film kam allerdingts schon zwei Jahre vor „Iron Sky“ heraus – und plagiiert gewissermaßen die „Mondverschwörung“.
Es gibt leider einen gewissen Bezug der Verschwörerszene zu Oldenburg, in Ihrem Film taucht auch ein Physiker auf, der sagt er habe in Oldenburg studiert. Gleichzeitig ist Oldenburg durch Werner Altnickel ein Zentrum der Chemtrail-Erzählung, der verstorbene ‚Honigmann‘ kam ebenfalls aus der Nähe Oldenburgs und jüngst gibt es enge Beziehungen zur ‘Querdenken’-Demobewegung. Sie verfolgen ja in dem Film, und noch mehr in ‚Deckname Dennis‘ durchaus auch eine lokale Erklärung, nämlich eine bezogen auf Deutschland und die deutsche Ideologie. Gibt es denn etwas, dass die Orte, in denen Verschwörungstheorien auf Resonanz stoßen, eint?
Das mit Oldenburg war mir gar nicht klar. Zumindest in Bezug auf die Verbreitung esoterischen Gedankenguts erkannten die Experten vor einigen Jahren noch ein Nord-Süd-Gefälle. Da galten Stuttgart oder München als deutsche Esoterik-Hauptstädte, aber es mag sein, dass sich das allmählich über das ganze Land verteilt. Andererseits hätte ich einen solchen Film natürlich auch in ganz anderen Ländern machen können, zum Beispiel in Polen oder in den USA, wo Dennis Mascarenas ja herkommt. Dort gehören Teile dieser Szenen ja gewissermaßen schon zur Folklore. Trump ist dafür nur ein Extrembeispiel. In Deutschland kommt nun aber eben zu diesem in vielen Ländern verbreiteten Verschwörungsdenken die spezifische deutsche Geschichte hinzu. Dieses, was wir schon als eine Vereinfachung komplexer Wirklichkeit, komplexer Probleme angesprochen haben, findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern bedient sich an all dem, was es schon so gibt an Erklärungen. Das steht hier dann schnell in einer rechten Tradition. Wenn die Leute in dem Film von Reichsdeutschen reden, vom Neuschwabenland oder den Ariern, dann bedienen sie sich an nationalsozialistischem Material. Eine Besprechung des Vorgängers der ‚Mondverschwörung‘, dem von Ihnen angesprochenen ‚Deckname Dennis‘ hat das Vorgehen als eine „ethnologische Reise ins eigene Land“ bezeichnet, das finde ich treffend.
Wie war es eigentlich ganz konkret beim Dreh? Im Film stellt sich ja Dennis Mascarenas als Reporter und eigentlicher „Macher“ des Films vor. Wo waren sie bei der Entstehung des Films? Waren Sie immer anwesend, sozusagen als Teil des Filmteams um Dennis Mascarenas?
Naja – so war es ja auch. der Kinofilm ist sozusagen das „Abfallprodukt“ der DDC-Reportagen. Allerdings habe ich die ganzen Dreharbeiten organisiert und die Gesprächspartner ausgesucht, auch die Interviews habe ich mit Dennis vorbesprochen. Und ich war auch immer selbst dabei – und zwar hinter der Kamera. Viele der Interviews haben mehr als eine Stunde gedauert, manche sogar noch länger. Im Film ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen gelandet. Auf der DVD findet sich einiges Zusatzmaterial, das ich im Kino selbst nicht gezeigt habe.
Auf dieser kann man auch die empörte Reaktion eines der Interviewten beobachten, der meinte alles sei nur von Ihnen aus dem Kontext gerissen worden. Er bekommt dann tatsächlich die Chance auf einen ungeschnitten Beitrag, bei dem er dann aber nur demonstriert, dass es eigentlich noch viel schlimmer ist als das, was sie gezeigt haben. Wie waren denn andere Reaktionen? Immerhin haben Sie die Interviews ja schon unter falschen Vorzeichen geführt.
Dem muss ich entschieden widersprechen. Wir sind weder unter falscher Flagge gesegelt noch haben wir sinnentstellend in das Material eingegriffen. Alle Interviewten hatten die Möglichkeit, sich selbst und ihr Anliegen ausführlich darzustellen. Und nun ist es in unserer Medienwelt ja so: wenn sich Leute freiwillig vor eine Kamera stellen, haben sie in aller Regel keinen Einfluss auf den Verwendungszusammenhang der dabei entstandenen Bilder. Das ist auch juristisch so geklärt, es nennt sich „konkludente Einwilligung“. Ich musste die Leute aber auch nie groß dazu überreden etwas zu erzählen. Diese Menschen haben einen unheimlich missionarischen Eifer, wenn man ihnen ein Mikrofon hinstellt, dann erzählen sie auch drauf los. Natürlich mussten die langen Interviews später auf das wesentliche gekürzt werden. Dadurch mag die eine oder andere satirische Zuspitzung hineingekommen sein. Aber es wurde nichts aus dem Zusammenhang gerissen. Im Gegenteil: ich habe viele der Aussagen erst in einen größeren Zusammenhang hineingestellt.
Es ist ja auch von besonderer Pikanterie, dass der Interviewer im Film ein Amerikaner ist, obwohl die Leute sich neben ihrem offenen Antisemitismus auch durch Antiamerikanismus auszeichnen. Amerika ist für sie Sinnbild alles Schlechten. Und doch sind sie dem amerikanischen Interviewer gegenüber so offen. Das ist zum einen der Interviewart von Dennis geschuldet. Er hat außerdem einen indianischen Ursprung, das machte ihn wohl für viele der Interviewten sympathisch.
Das führt zu einer Frage die Gattung des Dokumentarfilms betreffend. Zu diesem gab es eine klassische Debatte, die eine recht strenge moralische Forderung an ihn stellte, dass diese eine Art neutrale Abbildfunktion der Wirklichkeit zu erfüllen habe, in die der Dokumentarfilmer nicht künstlich einzugreifen habe, er solle, in einer bekannten Metapher, eine teilnahmslose „Fly on the Wall“ sein. Sie verletzen diese Regeln in ihren Filmen offenkundig, weil sie als ‚Mockumentary‘ schon auf einer Art ‘Lüge’ bzw. allemal Fiktion basiert.
Der Film wurde oft Mockumentary genannt, wie Sie es auch gerade getan haben. Ich selbst würde ihn nicht so nennen. Es ist ja keine fiktive Dokumentation. Alle Interviews sind echt und so abgelaufen, wie ich es zeige. Im Übrigen gibt es ja viele verschiedene dokumentarische Ansätze. In unserem Berufsverband, der AG DOK, deren Vorsitzender ich ja fast vierzig Jahre war, haben wir darüber oft diskutiert. Ich glaube, die Vorstellung, dass ein Dokumentarfilm ein bloßes Abbild der Wirklichkeit sein kann, ist eine Illusion. Ich treffe als Dokumentarfilmer unzählige Entscheidungen, die den Eindruck der Wirklichkeit beeinflussen: was ich zeige, in welchem Ausschnitt ich zeigen, wie ich es montiere und in den Ablauf des Films einbaue. All das ist nie ganz neutral. Damit bin ich bereits nicht mehr nur ‚Fly on the Wall‘.
Was den Film zu einer ‚Mockumentary‘ macht ist wohl die fiktive Geschichte, um die herum die Interviews spielen.
Dass Dennis als Geheimagent im Auftrag der amerikanischen Regierung unterwegs ist – das ist natürlich ein fiktives Element. Aber ‚Dennis Mascarenas‘ ist sein richtiger Name und er arbeitet wirklich für den privaten Fernsehsehsender Denver Documentary Channel (DDC).
Auch wenn das, was sie über den Dokumentarfilm sagen, einleuchtend ist, so gibt es doch aber einen Unterschied zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm. Was ist denn nun das Dokumentarische am Dokumentarfilm?
Die Grenzen zwischen den Gattungen verwischen in den letzten Jahren zunehmend. Ich denke: was den Dokumentarfilm auszeichnet, ist sein Anspruch der Authentizität. Das, was er zeigt, muss schon in der Wirklichkeit vorfindbar sein. Zudem sollte ein guter Dokumentarfilm auch ergebnisoffen an die Wiirklichkeit herangehen. Gut recherchiert – ja. Aber man muss nicht schon von Anfang an wissen, was für ein Ergebnis es am Ende gibt, kein vorgefertigtes Bild davon zu haben, wie der Film am Ende genau sein wird, sondern man sollte sich von dem, was einem begegnet, leiten lassen.
Seit dem Film kam es zu einem kleinen Boom im Genre der ‚Mockumentary‘, jüngst wurde viel über den Fall Borat disktuiert, der kurz vor der Präsidentschaftswahl einen Film über die amerikanische Rechte, nicht zuletzt auch das Verschwörungsmilieu, veröffentlicht hat. Wenn man den Borat-Film mit Ihrem vergleicht fällt im Umgang mit den gezeigten Interviewpartnern auf, dass Sie die Leute nicht dermaßen vorführen, auch wenn es diese Übertreibung gibt. Würden Sie zustimmen?
Den neuen Borat-Film kenne ich noch nicht. Aber es gab Veranstaltungen, in denen die „Mondverschwörung“ und der erste Borat-Film parallel gezeigt und diskutiert wurden. Ich habe dabei nachgewiesen, dass „Borat“ tatsächlich sinnentstellend in das Material eingegriffen hat, indem zwischen Frage und Antwort erkennbare Schnitte lagen. Um diesem Verdacht zu entgehen, habe ich auf der DVD ja Teile des Aufnahmematerials ungeschnitten wiedergegeben um damit zu zeigen: alle hatten die Möglichkeit, sich selbst und ihr Anliegen darzustellen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass einige diese Möglichkeit genutzt haben, um sich und ihr Anliegen bloßzustellen.
Ist das eine Verführung beim Dokumentarfilm, gerade in den aktuellen politischen Zeiten, noch extremer zu werden in der Konstruktion der Geschehnisse?
Ich glaube eher, dass man sich nichts ausdenken kann, was nicht irgendwann durch die Realität getoppt wird. Schon für einen meiner frühen Filme habe ich mit dem Slogan geworben: „Nichts ist so grotesk wie die Wirklichkeit“. Und das gilt im Milleu rechter Verschwörungstheoretiker allemal. Allerdings gibt es für uns dort heute kaum noch etwas zu enthüllen, weil die Protagonisten ihre Ansichten ja bereits selbst offensiv nach außen tragen. Das war übrigens auch schon der Ansatz im ersten „Dennis“-Film: „undercover“ ist out – der Geheimagent von heute ist Journalist und muss einfach nur fragen…
Bis Anfang des Jahres waren Sie Vorsitzender der AG Dok. Vor kurzem haben Sie nun den ersten deutschlandweiten Dokumenterfilmtag ins Leben gerufen, unter dem Motto »Let’s DOK!«. In einer Stellungnahme dazu heißt es, dass der Dokumentarfilm „dazu beitragen kann, die Gräben zu überwinden, die zwischen den unterschiedlichen Gruppen, Lagern und Milieus aufgebrochen sind.“ Ich habe mich dann gefragt, wodurch er das eigentlich könnten sollte. Bei den Milieus, wie sie sie in ihren Filmen zeigen, entsteht vermutlich der Eindruck, dass es da eigentlich kaum eine Versöhnung geben kann.
Ich glaube schon, dass der Film das kann, sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Ér muss es sogar. Denn was wäre die Alternative? Sollen wir die Parallelwelten weiterlaufen lassen, bis sie sich verselbständigen? Da ist es doch besser, wenn wir erfahren, wie andere ticken und warum sie glauben, so handeln zu müssen. Das ist auch das, was wie wir in der AG DOK immer in den Gesprächen mit der Politik und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen argumentiert haben. Diese Funktion gibt dem Dokumentarfilm eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Mit ihm erforschen wir Möglichkeiten miteinander in Gespräche zu kommen. Wobei ich nicht ausschließen will, dass es auch fälle gibt, wo das nicht mehr geht.
In beiden Filmen ist man von der Flut an kruden Bildern und Äußerungen und den dargestellten Personen und Milieus geradezu überfordert. Einer Erklärung für das, was sie darstellen, enthalten Sie sich außerdem weitgehend, sie wiederholen immer nur durch den Protagonist Dennis Mascarenas die Frage, wie es sich denn nun erklären lässt. Ist dieser Rahmen des wertfreien Interviewers auch eine Parallele von Dokumentarfilm und Wissenschaft – Sie haben es ja auch gerade ‚forschen‘ genannt?
Diese Überforderung, die Sie schildern, kann ich gut nachvollziehen. Meine Filme haben jedenfalls nicht den Anspruch, alle Fragen zu beantworten. Uns ging es ja auch nicht anders, wir wollten gerne verstehen, was diese Leute antreibt. Die Haltung des Forschers ist dafür ein Bild. Das deutete die Formulierung „Ethnographische Reise ins eigene Land“, die ich schon erwähnte, an. Übrigens gibt es viele Ethnographen, die später Dokumentarfilmer geworden sind. Sie haben festgestellt, dass sie durch das Medium Film etwas erreichen, was sie sonst gar nicht schaffen können, mit bloßen Protokollen und schriftlichen Berichten. Trotzdem sehe ich das Filmemachen aber nicht als wissenschaftliche Arbeit, sondern als eine Kunstform.
Meine Filme sind deshalb auch nicht neutral oder wertfrei. Durch die Pointierung und die fiktiven Elemente beziehen sie schon Stellung. Aber so, dass dem Publikum genug Raum bleibt, eine eigene Haltung zu dem Gesehenen zu entwickeln. Früher war ich da sehr viel direkter. Mein erster Film war das Gegenteil eines neutralen Berichts. Es war ein politisch eingreifender Dokumentarfilm. Der Film heißt „Keine Startbahn West“ und er enthält eine unmittelbare Aufforderung, nämlich die Flughafenerweiterung in Frankfurt zu verhindern. Die Aufforderung ist nicht versteckt, sondern schon im Filmtitel, keine Startbahn, enthalten. Ich wollte damals am liebsten, dass die Menschen nach dem Film aufspringen und demonstrieren gehen. Aber so funktioniert die Wirkung von Filmen heute nicht mehr. Wenn Leute den Film gesehen haben, über einzelne Aspekte nachdenken und mit anderen darüber diskutieren, dann ist schon viel erreicht.
Ein Zuschauer hat mir mal geschrieben, dass seine Freundin auch der Esoterik anhing. Sie haben sich dann ‚Die Mondverschwörung‘ zusammen angesehen und das hat diese Frau offenbar dazu gebracht, ihr seitheriges Verhalten kritisch zu hinterfragen. Wenn ein Film diese Wirkung haben kann, dann bin ich natürlich zufrieden.
Interview von Ulrich Mathias Gerr